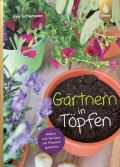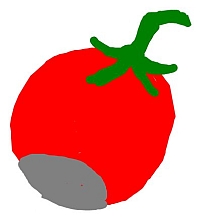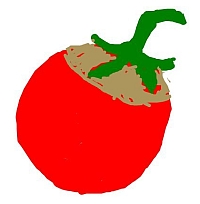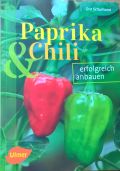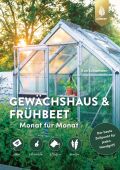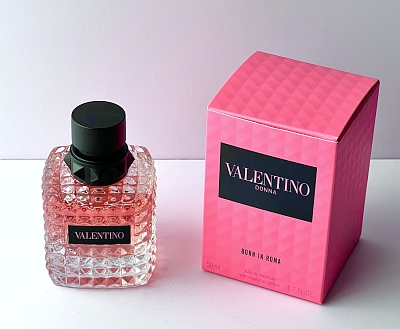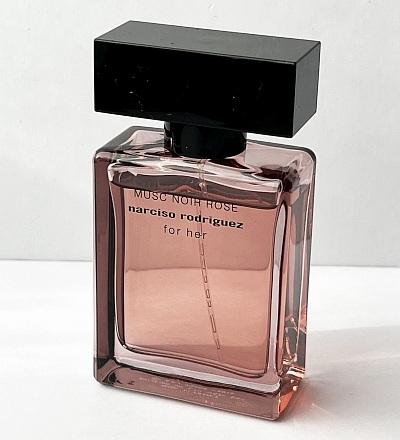Angesichts der vielen Vorgärten, die in den letzten Jahren mit nacktem Schotter oder Kies bedeckt wurden, schlagen sich viele Pflanzenliebhaber, Ökologen und Stadtklimaforscher die Hände vor den Kopf: „Wissen die denn nicht, dass das dem Artensterben und dem Klimawandel Vorschub leistet? Und wie das aussieht – vor allem nach einigen Jahren.“ Aber natürlich hat es einen Grund, wenn sich die Schottergärten (Steinschüttungen statt Bepflanzungen) ausbreiten. Die möglichen Ursachen und Beweggründe und welche besseren Lösungen es gibt. (Meinungsbeitrag mit Tipps für Gartenneulinge, zuletzt aktualisiert am 20.06.2023)


Unter Schottergärten verstehe ich in diesem Beitrag Schotteraufschüttungen ganz oder fast ohne Pflanzen. Es gibt natürlich auch „echte“ Kiesgärten, die ein Refugium für meist trockenheitsverträgliche Pflanzen sind. Dadurch, dass sie einer Vielzahl blühender Pflanzenarten einen artgerechten Standort bieten, haben sie auch eine positiven Einfluss auf die Artenvielfalt der Fauna (Schmetterlinge, Wildbienen & Co.).
Anzeige
Warum sich der Schottergarten-Trend meiner Meinung nach überhaupt ausbreiten konnte:
- Es gibt den Wunsch und oft auch die Notwendigkeit der Arbeits- und Zeitersparnis
Nicht jeder hat die Zeit und/oder die Kraft, sich um den Garten oder Vorgarten zu kümmern. Manche Menschen sind beruflich viel, manche regelmäßig tagelang unterwegs und/oder sie haben generell lange Arbeitstage, Phasen mit schwierigen Schichten oder andere Herausforderungen. Andere fürchten, die Wasserkannen nicht schleppen und Rasen nicht mähen zu können (altersbedingt, kräftemäßig oder durch andere Einschränkungen). - Gärtnerische Überforderung
Wer ohne Garten aufgewachsen ist, hat möglicherweise eine Scheu, alleine die Verantwortung für einen Garten zu übernehmen, zu pflanzen und zu pflegen. - Kosten
Auch für einen handtuchgroßen Garten oder Vorgarten braucht man Gartengeräte, sei es den Rasenmäher und Rasenkantenschneider, sei es Grabgabel, Grubber und Rechen, wenn man ein Beet anlegen möchte. - Gartentrend/Modetrend
Vor einigen Jahren kam es in einigen „Szenen“ in Mode, möglichst minimalistisch zu gestalten – leider aus Sicht der Artenvielfalt und des Klimas. Plötzlich gab es überall in Form geschnittene Immergrüne, Solitäre, und Hecken, die einen monoton grünen Rasen zierten. Grundsätzlich ist meiner Meinung nichts gegen Hecken oder Formgehölze zu sagen, wenn man zusätzlich auch anderes hat: Blühendes für Bienen und andere Insekten, Raupenfutterpflanzen für Schmetterlinge, Verstecke und Futterfundorte für Vögel und Ähnliches mehr. -
Schlechte Beratung
Ich habe den Eindruck, dass die Architekten/Bauherren/Eigentümer zu wenig über Pflanzen, Natur und Klima wissen und andererseits vermutlich auch weniger Arbeit mit der Planung eines Schottergartens haben, wodurch sie dann auch dem Wunsch des Auftraggebers, Kosten einzusparen, leichter entsprechen können. Hauptsache, es macht sich gut im Plan und bei der Abnahme kann man etwas ordentlich Aussehendes übergeben und fotografieren.
Doch die Freude an Schotteraufschüttungen wird bald getrübt
AnzeigeSchottergärten haben so viele Nachteile:
- Das Klima am und im Haus ist im Sommer heißer und trocken.
- Wegen der fehlenden Pflanzen wird kein Schmutz und Staub aus der Luft gefiltert.
- Wegen der fehlenden Pflanzen wird der Straßenverkehr und sonstiger Schall stärker übertragen.
- Mit der Zeit werden Schottergärten unansehnlich und es siedelt sich sehr wohl unerwünschte Pflanze („Unkraut“) an.
Warum Pflanzen die bessere Lösung sind
Egal, wie groß oder wie klein der Vorgarten ist, es gibt viele Gestaltungmöglichkeiten.
Wer den Blick auf die Straße und die Nachbarn freihaben möchte, sät oder pflanzt niedrige Arten. Wer für ein kühleres frischeres Klima im Haus und überhaupt für mehr Privatsphäre sorgen möchte, der pflanzt (auch) höhere Pflanzen.
Im Prinzip können dies ein- oder mehrjährige Pflanzen sein. Doch Pflanzungen, die auf mehrere Jahre angelegt sind, sind nachhaltiger, langfristig preiswerter und machen weniger Arbeit.

- Pflanzen sorgen für ein schöneres Stadtbild, der Anblick von Grün tut der Seele gut.
- Pflanzen schaffen ein besseres Stadtklima, beispielsweise sind die Temperaturen und Luftfeuchte im Sommer viel angenehmer als ohne.
- Durch Pflanzen entsteht ein besseres Kleinklima am Haus, wodurch auch die Temperatur und Luftfeuchte im Haus angenehmer bleibt – vor allem in heißen Sommern unschätzbar wertvoll.
- Pflanzen halten Straßenstaub und Luftverunreinigungen durch Fahrzeuge ab und sie dämpfen die Geräusche, die zum Haus gelangen. Der Effekt ist abhängig von der Höhe der Pflanzen und wie breit/tief die Bepflanzung ist.
- Begrünungen sind besser für die Artenvielfalt – von Bodenlebewesen über Wildbienen bis zu den Vögeln werden die Tiere gefördert, was auch den Menschen zugutekommt (ohne Bestäuber fielen viele Nahrungspflanzen aus). Die ökologische Vielfalt und Vernetzung der Lebewesen eines Ökosystems schafft eine gewisse Stabilität, weil (vorübergehende) Störungen ausgeglichen werden können.
Pflanzen, die das Leben leichter machen
Es gibt Pflanzungen, die kaum Pflege brauchen, und es gibt Tricks, mit denen man unerwünschte Pflanzen, das Unkraut, unterdrücken kann.
Wenig Arbeit machen beispielsweise Gehölzpflanzungen (Sträucher, kleine Bäume), unter denen nach dem Anwachsen eine dicke Schicht Rindenmulch ausgebracht wird. (Tipp: Weil das Ausbringen von Rindenmulch Stickstoff bindet, einmalig mit Hornmehl oder einem anderen organischen Stickstoffdünger düngen.)
Arbeitssparend, schöner als Schotter und mit den Vorteilen lebender Pflanzen sind auch Anpflanzungen von pflegearmen Staudengemeinschaften, die zum Standort passen.

Aber die arbeitssparendste Bepflanzung ist die mit dauerhaften Bodendeckern.
Dauerhafte Bodendecker sind meist niedrige bis mittelhohe Gehölze oder Stauden, die den Boden nach kurzer Zeit dicht bedecken, so dass das Unkraut kaum eine Chance hat, sich an das Licht zu kämpfen. Wichtig ist nur, dass man sich Pflanzenarten aussucht, die zum Standort passen (Boden, Sonnenstunden, ob gegossen werden kann oder nicht etc.).
AnzeigeAn manchen Standorten wirken Mischbepflanzungen aus Stauden und Gehölzen, die über Jahre an ihrem Platz bleiben, am natürlichsten. Und wer noch mehr Farbtupfer möchte, pflanzt im Herbst noch Blumenzwiebeln für die Frühjahrsblüte im nächsten Jahr und im Frühling ein paar Blumen, die den Sommer verschönern, dazwischen. Man kann den Boden aber auch nur mit Stauden oder nur mit (niedrigen/kriechenden) Gehölzen bedeckt halten.
Entweder wendet man sich an eine/n Garten- und Landschaftsbau-Fachfrau/Fachmann, die den Vorgarten nach einer Beratung entsprechend anlegen, oder man geht in eine Baumschule und/oder Staudengärtnerei, lässt sich dort beraten und legt den Vorgarten dann selbst an.

Was man mit den Fachleuten neben den genauen Standortbedingungen besprechen sollte, ist, ob man heimische Arten bevorzugt, um möglichst viel für den Artenschutz zu tun, ob man für dieses Stück Garten besonders mit Farben und großen Blüten (von gezüchteten Sorten) etc. klotzen möchte oder wie man auch beides kombinieren könnte. Am Ende sollte der Vorgarten zu Ihnen passen, nicht zuletzt weil er von außen Ihre Visitenkarte ist und er andererseits das ist, was man sieht wenn aus dem Fenster auf den Eingangsbereich schaut..
AnzeigeHier noch ein paar Beispiele für Bodendecker:
Bodendecker für karge, trockene, sonnige Standorte
Aschgrauer Storchschnabel (Geranium cinereum): niedrige,polsterbildende Staude mit hübschen pinkfarbenen Blüten
Fingerstrauch (Potentilla) ‚Tilford Cream‘: bis zu 80 cm hoher Kleinstrauch mit cremefarbenen Blüten
Flügelginster (Genista sagittalis): bis zu 80 cm hoher, kriechender Zwergstrauch mit gelben Blüten (besonders für nährstoff- und kalkarme Böden)
Thymianarten (Thymus): Arten von 3 bis 30 cm Höhe in verschiedenen Blütenfarben


Bodendecker für schattigere Standorte
Waldsteinie (Waldsteinia ternata): bodenbedeckende, bis 80 cm hohe Staude mit gelben Blüten, die nährstoffreichen, durchlässigen Boden mag und kurzzeitige Trockenheit gut wegsteckt
Kleines Immergrün (Vinca minor): bis 15 cm hoher, bodenbedeckender Halbstrauch mit blauen Blüten, für nährstoffreichen Boden, der trocken bis feucht sein darf.
Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum ‚Mayflower‘), 50 bis 60 cm hoch, blauviolett blühend für frischen Boden auch neben Gehölzen
Mit der richtigen Pflanzenauswahl lässt sich viel Arbeit (und auch Wasser) einsparen. Wer sich dennoch unsicher fühlt und/oder beruflich viel unterwegs ist, kann sich möglicherweise mit anderen zusammentun oder jemanden für besondere Aktionen (wie beispielsweise den Rückschnitt im Frühjahr) engagieren.
Ihre Mietwohnung hat einen Schottergarten?
Vielleicht ist man aber auch in einem Haus oder einer Wohnung mit Schotterpisten-Vorgarten oder einem kahlen Hinterhof gelandet und hat nicht die Erlaubnis, die Mittel oder die Zeit diesen umzugestalten. Eine Möglichkeit der flexiblen Gestaltung, bei der Boden oder Bauteile nicht verändert werden müssen, ist die Gestaltung mit Pflanzen in Töpfen, Kübeln und anderen Pflanzgefäßen. Schon ein paar Akzente können das ganze Bild verbessern. Mit bepflanzten Kübeln und Töpfen lassen sich Eingänge einladend gestalten, Balkone in Kräuter- und Selbstversorgerparadiese, Duft- oder Schmetterlingsgärten, Hinterhöfe und Vorgärten in Bienenweiden und Vogelparadiese umwandeln. Mit einem „Topfgarten“ kann man sich künstlerisch, gestalterisch oder gärtnerisch austoben, auf jeden Fall sein Zuhause optisch und sogar klimatisch verbessern. Und wenn man wegzieht, kann man seine Lieblinge mitnehmen!

Wie das Gärtnern in Töpfen, Kübeln und anderen Pflanzgefäßen auf Balkon, (Dach-)Terrasse, im Garten und anderswo ganz nach individuellem Geschmack und Vorlieben funktioniert, habe ich anfängergerecht in diesem Buch beschrieben.
Gärtnern in Töpfen:*
Balkon und Terrasse mit Pflanzen gestalten*
Eva Schumann
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1. Auflage (2019)
Taschenbuch/Klappenbroschur, 128 S.,
86 Farbfotos, 3 Farbzeichungen, 17 Tabellen
ISBN 3-8186-0635-8
* Werbelink
Das könnte Sie auch interessieren
- Keine Angst vor Pflanzen (tinto bloggt)
- Buchvorstellung: Der Kies muss weg (tinto bloggt)
- Gartengestaltung mit Stauden (hobbygarten.de)
- Topfgarten – Balkon, Terrasse, Eingang, Sitzecken gestalten und nutzen (gartensaison.de)
- Pflanzen des Jahres 2024 (tinto bloggt)